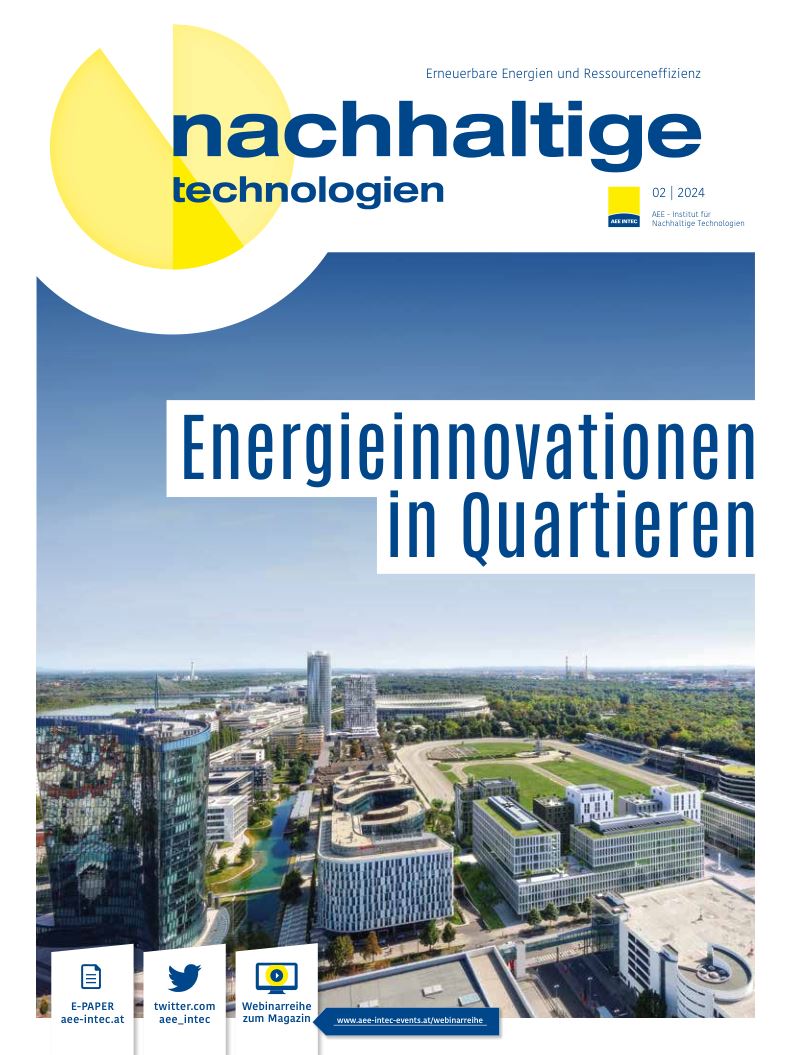2005-04: Nachhaltige Energieregionen
Energieregionen
 Die Hamburger HafenCity gehört zu den ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekten in Europa. Bis 2020 entsteht in der Hansestadt auf einer Fläche von 155 ha ein neues städtisches Quartier mit einer gemischten Nutzung aus Wohnen, Gewerbe, Freizeit und Kultur.
Die Hamburger HafenCity gehört zu den ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekten in Europa. Bis 2020 entsteht in der Hansestadt auf einer Fläche von 155 ha ein neues städtisches Quartier mit einer gemischten Nutzung aus Wohnen, Gewerbe, Freizeit und Kultur.
Wärmeversorgung der HafenCity Hamburg
Solarwärme als Baustein zur Erreichung der geforderten CO2-Emissionen
Geplant sind 5.400 Privatwohnungen sowie Büroräume für 20.000 Arbeitsplätze mit einer Gesamt-Bruttogeschoßfläche von 1,5 Mio. m². Um das Areal mit Wärme zu versorgen, setzt die städtische Projektentwicklungsgesellschaft HafenCity Hamburg GmbH (HCH) auf ein dezentrales Versorgungskonzept. Dieses kombiniert Fernwärme, Blockheizkraftwerke, Sonnenkollektoren und Brennstoffzellen. Dadurch können die CO2-Emissionen gegenüber konventionellen Brennwert-Gas-Heizungen um 35 % reduziert werden.
Nach einer europaweiten Ausschreibung erhielten die Hamburgischen Elektrizitätswerke AG (HEW), Bereich Fernwärme und Vattenfall Europe Contracting GmbH, Ende 2003 den Zuschlag der HCH für die Wärmeversorgung im westlichen Teil des neuen Stadtviertels.
Maßgeschneiderte Versorgungsmodelle
Die Vattenfall Europe Contracting GmbH gehört zu den Pionieren des Energiecontractings in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist Teil der Vattenfall Europe AG. Contracting ist eine moderne Energiedienstleistung für Industrie und Liegenschaften.
Hierbei wird das gesamte Versorgungsmanagement von der Planung über den Betrieb bis hin zur Energielieferung an einen externen Dienstleister übertragen. Diese Auslagerung verhilft dem Kunden zu einer deutlichen Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt und der Energieressourcen, wobei die erforderlichen Investitionen sehr oft vom Contractor getätigt werden.
HafenCity Hamburg
Im größten städtebaulichen Quartier Europas, dem Projekt Hamburger HafenCity, werden höchste ökologische Ansprüche umgesetzt.
Die städtische Projektentwicklungsgesellschaft hat sich nach einer zunächst zweijährigen Gutachten-Phase zum Thema „Nachhaltige Infrastrukturleistungen für die Hamburger HafenCity“ dazu entschlossen, die Wärmeversorgung für den westlichen Teil des neuen Stadtviertels (822.000 m² BGF) mit Unterstützung der Firma Megawatt europaweit als öffentliches Auftragsvergabeverfahren auszuschreiben und zwar „variantenoffen“ und im Verhandlungsverfahren. Das Vergabeverfahren bot den Teilnehmern die Freiheit bei der Auswahl der technischen Versorgungslösungen bei Einhaltung bestimmter wirtschaftlicher und ökologischer Kriterien. Zu den wichtigsten Vorgaben gehörten:
- Festsetzung einer Obergrenze der CO2-Emissionen für die Wärmeerzeugung von 200 g CO2/kWh im Jahr 2004, fallend auf 187 g CO2/kWh in den zehn Folgejahren
- Verbindliche Nutzung von solarthermischen Anlagen auf Grundlage des Bebauungsplanes bei Gebäuden mit zentraler Warmwasserbereitung
- Flexibilität bezüglich des Einbezugs zukünftiger technischer Entwicklungen
- Garantie eines heute und zukünftigen attraktiven Wärmepreises für die Investoren und Nutzer.
Durch das kombinierte Vattenfall-Angebot konnte ein zukunftsweisendes Konzept umgesetzt werden: einerseits die bewährte Hamburger Fernwärmeversorgung, andererseits dezentrale Wärmeerzeugungseinheiten wie Blockheizkraftwerke (BHKW), Brennstoffzellen und Solartechnik. Durch diesen Brennstoff- und Erzeugermix können die CO2-Emissionen gegenüber einem konventionellen Vergleichsstandard mit Brennwert-Gas-Heizungen um 35 % reduziert werden.
Sonnenenergie
Für die eingesetzten Technologien zur dezentralen Energieerzeugung zeichnet Vattenfall Europe Contracting verantwortlich. Die Gebäude im Bereich des Dalmannkais, die überwiegend zum Wohnen genutzt werden, erhalten solarthermische Anlagen. 40 % des benötigten Warmwassers sollen durch die Sonnenenergie erwärmt werden. Hierfür sind thermische Sonnenkollektoren mit einer Leistung 1.260 kWth (1.800 m2) vorgesehen (siehe auch Abbildung 1Abbildung 1).
Abbildung 1: Energiekonzept für den westlichen Teil der Hamburger HafenCity
Brennstoffzelle
In den Bereichen „Strandkai“ und „Westlich Magdeburger Hafen“ wird das vorhandene Fernwärmenetz mit zwei zusätzlichen Energiezentralen mit BHKW ergänzt. Weiterhin wird Ende des Jahres 2005 eine Pilot-Brennstoffzelle der MTU CFC Solutions am Heizwerk HafenCity auf dem Grasbrook installiert werden. Die Zelle vom Typ "HotModule" hat 245 kW elektrische und 180 kW Wärmeleistung und ist Teil des entwickelten Konzeptes zur Energieversorgung. Zusätzlich ist die Umrüstung des Heizwerks HafenCity mit einer Dampfturbine mit 2 MW elektrischer Leistung zu einem Heizkraftwerk geplant.
CO2-Emissionen
Ausgehend von spezifischen CO2-Emissionen für die Hamburger Fernwärme von 203 g/CO2kWh – Berechnung nach GEMIS 4.14 inkl. Brennstoffvorkette – reduzieren die Einzelmaßnahmen die CO2-Emissionen der Wärmeversorgung für den westlichen Teil der HafenCity im Endausbau von 9.945 tCO2/a in Summe um 2.110 tCO2/a (21,2 %). Abbildung 3Abbildung 2 zeigt die CO2-Emissionen und die CO2-Minderungen der Einzelmaßnahmen. Die Solarthermie hat dabei einen Anteil von knapp 2 % (165 tCO2/a) bezogen auf die CO2-Emissionen der gesamten Wärmeerzeugung bzw. knapp 8 % bezogen auf die gesamten CO2-Minderungen.
In Summe konnten die Anbieter auf diese Weise die Umwelt- und Klimabelastung durch das Verbrennen fossiler Energieträger unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien mit einen CO2-Äquivalent von 160 g/kWh auf ein Minimum reduzieren.
Abbildung 2: CO2-Emissionsbilanz für die Wärmeversorgung der HafenCity Hamburg inkl. Brennstoffvorkette
Erläuterung: Baseline = 100 % Fernwärme mit Erzeugungsmix 2001: Steinkohle-HKW (79,4 %), Haus- und Gewerbemüll-HKW (10,7 %), Erdgas-HW (7,9% %), Heizöl-HW (2%)
Solarthermie in der HafenCity
Auf der Basis des Hamburger Klimaschutzgesetzes hat die Freie und Hansestadt Hamburg das Hamburger Energiegesetz erlassen. Dieses schreibt u. a. für städtische Entwicklungsflächen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens im Falle einer zentralen Warmwasserbereitung einen mindestens dreißigprozentigen Deckungsanteil mittels erneuerbare Energien verbindlich vor.
Die konkrete Umsetzung dieser Vorgabe geschieht im Energiekonzept mittels solarthermischer Anlagen zunächst im Bereich des Dalmannkai mit überwiegender Wohnbebauung und sieht folgendes Konzept vor:
- Fernwärme-Gebäudeanschluss für Heizung und in Sonderfällen Warmwassernacherwärmung
- Bau und Betrieb einer Flachkollektoranlage- oder in Sonderfällen Vakuumröhrenkollektoranlage (Abbildung 5Abbildung 3) mit einem Deckungsgrad von 35 % bis 40 % des Warmwasserbedarfes als hydraulisch von der Fernwärme getrenntes Brauchwarmwasser-Vorwärmsystem
- Dachnutzungsvertrag für die solarthermische Anlage über die Laufzeit der Wärmelieferung, hier 10 Jahre
- Getrennte Zählung der Fern- und Solarwärme, jedoch Abrechnung von Fern- und Solarwärme über einen Wärmeliefervertrag
- Garantierter solarer Ertrag im Rahmen der „Ertragsgarantie Hamburger Solaranlagen“ gemäß Förderrichtlinien der Hansestadt Hamburg
Abbildung 3: Beispiele einer flachdachmontierten Flach- (linkes Bild) und Vakuumröhren-kollektoranlage (rechtes Bild) (Fotos: Viessmann Werke)
Die Kollektoren auf den Dächern sollen aus städtebaulichen Gründen möglichst wenig sichtbar sein. Auch fällt die Bebauung der einzelnen Baufelder auf dem Dalmannkai kleinteiliger als ursprünglich geplant aus. Des weiteren konkurriert die Solarthermie mit Restriktionsflächen für Dachgärten und Aufbauten von haustechnischen Anlagen. In der Summe führen diese Umstände zu einer größeren Stückelung der geplanten 1.260 kWth bzw. 1.800 m² Solarkollektorfläche: statt 12 Einzelanlagen von je 100 und 200 m² Kollektorfläche jetzt ca. 20 Einzelanlagen von je 30 und 120 m² Kollektorfläche. Die Realisierung der ersten solarthermischen Anlage ist für Ende des Jahres 2005 geplant, weitere folgen in den Jahren 2006 und 2007 nach Baufortschritt.
Wärmekostenvergleich
Als Realisierungsvarianten kommen aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt Flachkollektoren mit 30° Neigung und nur in Ausnahmefällen liegende Vakuumröhrenkollektoren in Betracht. Abbildung 7Abbildung 4 zeigt die solaren Wärmekosten für zwei Anlagengrößen (50 und 100 m² Kollektorfläche, das entspricht 35 und 70 kWth) auf. Die Kosten für die mit Vakkuumröhrenkollektoren erzeugte solare Wärme liegen etwa 50 % höher als die mit Flachkollektoren bei ansonsten gleichen Anlagenkonfigurationen und identischen Randbedingungen.
|
Solare Wärmekosten - HafenCity Hamburg
Beispiel: Komplette Brauchwarmwasser-Vorwärmanlage |
||||
|
50 m² Solarthermische Anlage
|
100 m² Solarthermische Anlage
|
|||
|
Flach-
kollektor |
Vakuum-
röhrenkollektor |
Flach-
kollektor |
Vakuum-
röhrenkollektor |
|
| Technische Daten | ||||
| Kollektorfläche [m²] |
49
|
53
|
95
|
97
|
| Aperturfläche [m²] |
46
|
36
|
89
|
66
|
| Pufferspeicher [Liter] |
1.800
|
1.800
|
2.700
|
2.700
|
| Vorwärmspeicher [Liter] |
350
|
350
|
500
|
500
|
| Kapitalkosten | ||||
| Spez. Kosten [€/m²] |
480
|
580
|
450
|
540
|
| Investition [€] |
23.520,00
|
30.740,00
|
42.750,00
|
52.380,00
|
| Planung [€] |
2.352,00
|
3.074,00
|
4.275,00
|
5.238,00
|
| Hamburger Solarprogramm [€] |
-7.360,00
|
-6.480,00
|
-14.240,00
|
-11.880,00
|
| BAFA-Förderung [€] |
-5.390,00
|
-5.830,00
|
-10.450,00
|
-10.670,00
|
| Kapitaldienst [15 a; 7 %] [€] |
2.032,52
|
3.001,13
|
3.599,62
|
5.021,79
|
| Kapitaldienst [15 a; 7 %] mit BAFA [€] |
1.440,73
|
2.361,02
|
2.452,26
|
3.850,28
|
| Betriebskosten | ||||
| Wartungskosten in [€/a] |
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
| Instandsetzung 1 % [€/a] |
235,20
|
307,40
|
427,50
|
523,80
|
| Ertrag | ||||
| Solare Einstahlung [kWh/m²,a] |
956
|
956
|
956
|
956
|
| Warmwasserbedarf [kWh/a] |
54.857
|
54.857
|
104.000
|
104.000
|
| Solarer Ertrag [kWh/a] |
19.200
|
19.200
|
36.400
|
36.400
|
| Deckungsrate [%] |
35
|
35
|
35
|
35
|
| Solare Wärmekosten [€/MWh] |
127,5
|
181,7
|
115,6
|
157,3
|
| Solare Wärmekosten mit BAFA [€/MWh] |
96,7
|
148,4
|
84,1
|
125,1
|
Tabelle 1: Wärmekostenvergleich solarthermischer Anlagen mit und ohne BAFA-Förderung
Im gesamten Energiekonzept für die Wärmeversorgung liefert die Solarthermie mit einem knapp zweiprozentigen Wärmeerzeugungsanteil zwar nur einen geringen Beitrag. Bezüglich der Erreichung der geforderten Obergrenze der CO2-Emissionen liefert die Solarthermie jedoch einen knapp achtprozentigen Anteil an der gesamten CO2-Minderung und ist damit ein wichtiger wirtschaftlicher Baustein im Gesamtkonzept.
*) Dipl.-Ing. Jörg Asmussen ist Projektleiter bei der Vattenfall Europe Contracting GmbH mit den Schwerpunkten Arealversorgung mir Erneuerbaren Energien / Kraft-Wärme-Kopplung und Energiesparcontracting und u. a. verantwortlich für die denzentrale Wärmeerzeugung in der HafenCity Hamburg, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. [^]